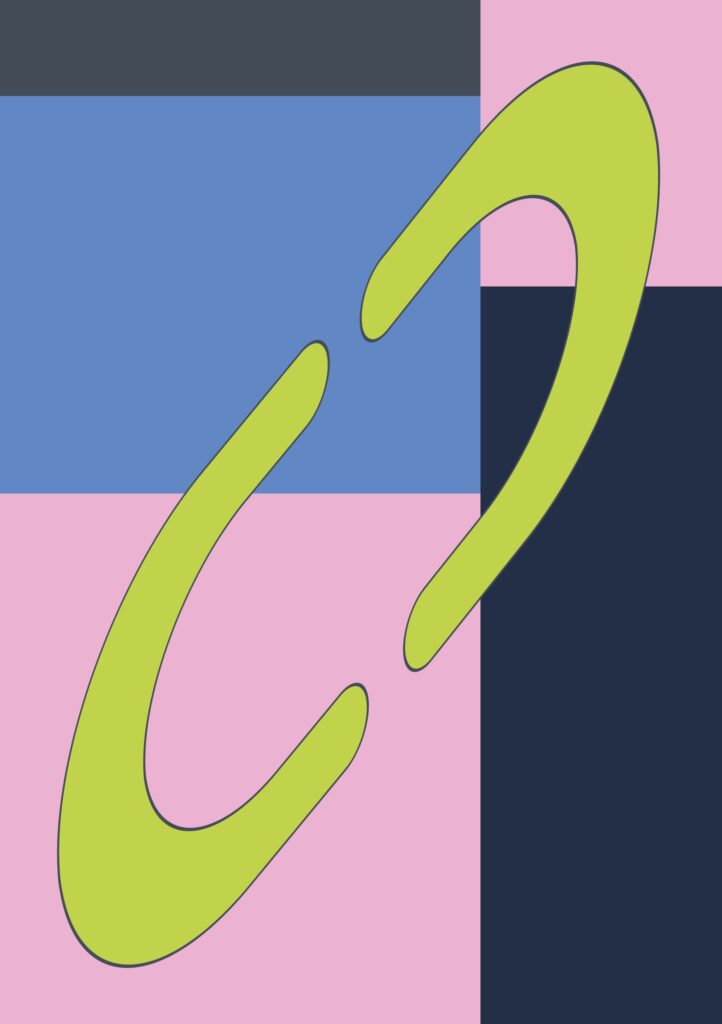Ausstellung
22.8. – 2.11.2025
Kuratiert von
Janine Pauleck
Programmkoordination
Josephine Steffens
Hannah van der Est
Die Ausstellung »Politics of Being Heard« (Politik des Gehörtwerdens) ist der dritte Teil des Jahresprogramms HANDLE (with) CARE.
Veranstaltungen
6.9.2025, 14 Uhr
Hör- und Tastführung mit Sebastian Schulze & Katrina Blach
13.9. & 14.9.2025, jeweils 12-13 Uhr
Tag des Denkmals
Führung mit Alice Lorenzon
5.10.2025, 17-19 Uhr
Nachbarschaftstreffen »Suppe, Tee & Zuhören«
19.10.2025, 15 Uhr
Programm KGB-Aktionstage:
Collage-Workshop Herbstanhänger gestalten
25.10.2025, 15 Uhr
Lesung von Sabrina Lorenz
»Weil Sonnenblumen auch im Winter blühen«
1.11.2025, 16-19 Uhr
Finissage
Eröffnung
Donnerstag, 21.8.2025
ab 19 Uhr
Eintritt frei
Der Bärenzwinger Berlin lädt herzlich zur Eröffnung der Gruppenausstellung »Politics of Being Heard« (Politik des Gehörtwerdens) am 21. August 2025 ab 19 Uhr ein.
Als dritte Ausstellung im Jahresprogramm HANDLE [with] CARE widmet sie sich Fragen nach Inklusion, Barrierefreiheit und institutioneller Verantwortung.
Die künstlerischen Positionen von Katrin Bittl, Seo Hye Lee, Anika Krbetschek und Zorka Lednárová setzen sich in unterschiedlichen Medien mit Barrieren, Teilhabe und Formen von Care auseinander. Katrin Bittl arbeitet in Videoperformances mit Selbstinszenierung und Assistenzsituationen, um Körpernormen, Zugänglichkeit und gesellschaftliche Hierarchien zu hinterfragen. Seo Hye Lee verbindet in textilen Arbeiten und Videoarbeiten persönliche Erfahrungen mit Hörverlust mit Fragen nach Zugänglichkeit, Sprache und geteiltem Verstehen.
Anika Krbetschek entwickelt in ihrer multisensorischen Rauminstallation sowie in der Außenarbeit eine vielschichtige Auseinandersetzung mit Fürsorge, psychiatrischer Gewalt und der Geschichte des Bärenzwingers, die Sound, Video, Geruch und Materialität verbindet. Zorka Lednárová übersetzt in einer Skulptur und dokumentarischen Fotografien persönliche Erfahrungen mit alltäglichen Barrieren in räumliche und körperliche Einschränkungen für das Publikum, um Perspektivwechsel und unmittelbare Konfrontation zu erzeugen.
Begleitet wird die Ausstellung von einem Rahmenprogramm, das inklusive Vermittlungsformate und künstlerische Beiträge verbindet. Geplant sind unter anderem eine Hör- und Tastführung, Textfassungen in einfacher Sprache sowie ein performatives Programm. Weitere Programmpunkte werden im Laufe der Ausstellung bekannt gegeben.
Hör- und Tastführung mit Sebastian Schulze & Katrina Blach
Samstag, 6.9.2025
14 Uhr
Treffpunkt: 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn am Eingang des Bärenzwingers.
Anmeldung erforderlich
Eintritt frei
Der Bärenzwinger Berlin lädt herzlich zur inklusiven Veranstaltung »Bilder im Kopf. Dialogische Kunstvermittlung zum Hören und Tasten« mit Katrina Blach (sehend) und Sebastian Schulze (blind) am Samstag, 6. September 2025, um 14 Uhr ein. Treffpunkt ist 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn am Eingang des Bärenzwingers.
Im Rahmen der Ausstellung »Politics of Being Heard« lädt der Bärenzwinger Menschen mit und ohne Sehbeeinträchtigung ein, sich über Werke der Ausstellung auszutauschen.
Die Ausstellung „Politics of Being Heard“ fragt, was es bedeutet, gehört zu werden – im Alltag, in Institutionen und in künstlerischen Kontexten. Im Zentrum steht der Umgang mit Barrieren, die Zugänge erschweren oder verhindern: physisch, strukturell und sozial. Der Bärenzwinger, ein denkmalgeschützter Ort mit eingeschränkter Barrierefreiheit, wird dabei selbst Teil der Auseinandersetzung. Die Ausstellung versteht sich als offener Prozess: Sie macht strukturelle Ausschlüsse sichtbar und fragt, wie Räume gestaltet sein müssen, damit sich mehr Menschen gehört fühlen – nicht als Ausnahme, sondern als selbstverständlicher Teil kultureller Öffentlichkeit. Die künstlerischen Beiträge zeigen, dass Ausschlüsse tief in gesellschaftlichen Strukturen verankert sind – und eröffnen neue Perspektiven auf Sichtbarkeit, Verantwortung und Care. In medienübergreifenden Installationen, Videos, Fotografien, Textilarbeiten und Skulpturen machen sie erfahrbar, wie vielschichtig Zugänglichkeit ist – und stellen die Frage, unter welchen Bedingungen Teilhabe in Kunst und Gesellschaft möglich wird.
Anmeldung
Die Teilnehmendenzahl ist auf 20 Personen begrenzt.
Bitte meldet euch bis spätestens 4. September 2025 telefonisch unter 030 901837461 oder per E-Mail an info@baerenzwinger.berlin
Unterstützung bei der Anreise nötig?
Wir holen euch gerne von der nächst gelegenen Haltestelle des ÖPNV ab. Bitte teilt uns diese Info bis spätestens zum 5.9.2025 per E-Mail an info@baerenzwinger.berlin
Katrina Blach arbeitet mit Fotografie, Video und partizipativen Formaten. Ein Schwerpunkt ihrer Praxis liegt in der inklusiven und dialogischen Kunstvermittlung, die sie als gemeinsamen Prozess des Entdeckens, Fragens und Reflektierens versteht. Dabei geht es ihr weniger um die reine Wissensvermittlung, sondern um die Schaffung von Begegnungsräumen, in denen unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen können. Blach entwickelt Projekte in Kunst und kultureller Bildung, die Empowerment fördern und Teilhabe ermöglichen.
Sebastian Schulze ist blind und seit vielen Jahren in der inklusiven Kunstvermittlung aktiv. Als Mitglied des Inklusionsbeirats am Museum der bildenden Künste Leipzig (MdbK) wirkte er daran mit, Ausstellungen für blinde und sehbehinderte Menschen zugänglich zu machen – etwa durch taktile Reproduktionen, Audiodeskriptionen und Braille-Informationen. Ihm ist wichtig, dass blinde Perspektiven von Anfang an in Projekte einfließen. Schulze versteht Kunstvermittlung als dialogischen Prozess, der verschiedene Sinne anspricht und Austausch ermöglicht.
»Tag des offenen Denkmals« im Bärenzwinger – Denkmalhistorischen Führungen mit Alice Lorenzon
Samstag und, 5.10.2025
14-16 Uhr
Anmeldung erforderlich
Eintritt frei
Am 13. und 14. September 2025 lädt der Bärenzwinger Berlin im Rahmen des Tags des offenen Denkmals jeweils von 12 bis 13 Uhr zu denkmalhistorischen Führungen mit Alice Lorenzon durch das historische Gelände im Köllnischen Park ein. Der Bärenzwinger, der 1939 mit den Berliner Stadtbären eröffnet wurde, war fast 80 Jahre lang Heimat mehrerer Generationen dieser symbolträchtigen Tiere. Bis zum Tod von Schnute, der letzten Bärin im Jahr 2015, prägten die Bären das Stadtbild. Heute wird der Bärenzwinger als Kulturdenkmal genutzt und bietet Raum für Ausstellungen und Veranstaltungen. Besucher:innen haben die Möglichkeit, mehr über die wechselvolle Geschichte des Ortes und seine aktuelle Nutzung als Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst zu erfahren.
Anmeldung
bis 12. September unter info@baerenzwinger.berlin
Alice Lorenzon ist Kunstvermittlerin mit einem besonderen Interesse an der Verbindung von Kunst und Geschichten. Nach einem Studium der Sprachen wandte sie sich der Kunst zu und arbeitet seit acht Jahren in kommunalen Galerien und Museen. Seit vier Jahren unterrichtet sie Kunst an der Kreativitätsgrundschule. Derzeit ist sie in der Klosterruine und im Bärenzwinger tätig, wo sie seit 2022 regelmäßig Führungen im Rahmen des Tags des offenen Denkmals anbietet. In ihrer Vermittlung interessiert sie, welche Themen und Eindrücke Besucher*innen aus der Geschichte eines Ortes mitnehmen und wie sich daraus neue Perspektiven auf Kunst und Gesellschaft eröffnen.
Nachbarschaftstreffen »Suppe, Tee & Zuhören«
Sonntag, 5.10.2025
17-19 Uhr
Keine Anmeldung erforderlich
Eintritt frei
Der Bärenzwinger lädt alle Nachbar*innen und Interessierten herzlich ein, am Sonntagabend zu einem gemütlichen Beisammensein bei Suppe und Tee vorbeizukommen. Dieses Mal steht das gemeinsame Zuhören im Mittelpunkt: Wir möchten Raum geben, Erfahrungen, Gedanken und Geschichten miteinander zu teilen.
Die aktuelle Ausstellung »Politics of Being Heard« (Politik des Gehörtwerdens) fragt, was es bedeutet, gehört zu werden – im Alltag, in Institutionen und in künstlerischen Räumen. Zugleich macht sie sichtbar, dass Zuhören eine Form von Care ist, die Zeit, Aufmerksamkeit und Offenheit erfordert.
Gemeinsam mit dem künstlerischen Leitungsteam der Galerie wollen wir an diesem Abend darüber ins Gespräch kommen: Wo fühlen wir uns gehört, wo nicht? Welche Strukturen brauchen wir, um einander wirklich zuhören zu können? Wie können wir in unserem Alltag Räume schaffen, in denen alle Stimmen Platz haben?
Bei Suppe und Tee laden wir euch ein, euch auszutauschen, zuzuhören und Nachbarschaft als einen Raum zu erleben, in dem neue Perspektiven und Gemeinschaft entstehen können.
Tagesprogramm KGB-Aktionstage mit Führung & Konzert
Samstag, 18.10.2025
13 Uhr: Kuratorische Führung
16 Uhr: Konzert
Keine Anmeldung erforderlich
Eintritt frei
Angela Ordu & FREE SPIRITZ
Das multikulturelle Berliner Frauenensemble FREE SPIRITZ wurde von der nigerianisch-deutschen Sängerin Angela Ordu gegründet und verwandelt mit spürbarer Freude vielfältige Musikstile, eigene Kompositionen und bekannte Lieder in groovige, tanzbare Musik. Ihr Repertoire reicht von Soul, Funk, Pop und Jazz bis zu afrikanischen Rhythmen – immer getragen von Energie, Lebensfreude und einem starken Gemeinschaftsgefühl.
Angela Ordu arbeitete in den 1990er Jahren mit zahlreichen bekannten Musiker*innen zusammen und war mit dem Song »Rhythm of Love« in den US-Charts vertreten. 2001 wurde ihre Karriere durch die Autoimmunerkrankung Lupus und einen Schlaganfall unterbrochen. Heute steht sie wieder auf der Bühne – Musik ist für sie Ausdruck von Lebensmut und Stärke. Sie ist Teil der Plattform PINC-Music, die inklusive Musikprojekte fördert, und engagiert sich darüber hinaus für die Aufklärung über Lupus.
Line-up:
Angela Ordu – Voc, Shakers (NGA/DE)
Josylyn Segal – Perc, Sax, Voc (USA)
Ria Rother – Bass, Drums (DE)
Andreza Jesus – Voc, Pandero (BRA)
Sol Okarina – Guit, Voc (COL)
Programm KGB-Aktionstage: Collage-Workshop Herbstanhänger gestalten
Sonntag, 19.10.2025
14:30 –17:30 Uhr
Keine Anmeldung erforderlich, Kommen und Gehen jederzeit möglich
Eintritt frei
Ab 12 Jahren
In Englischer & Deutscher Lautsprache
Wie sieht die Welt im Herbst aus? Und was wollen wir davon mitnehmen?
In diesem Workshop arbeiten wir mit Materialien aus dem Bärenzwingergarten und gefundenen Bildern, um kleine Collagen und schließlich Herbstanhänger zu gestalten.
Im gemeinsamen Austausch teilen wir, was wir aus diesem Jahr mitnehmen möchten: Farben, Formen, Erinnerungen, und übersetzen diese in tragbare kleine Collagen, die uns durch den nährenden Winter begleiten können.
Dieser Workshop findet im Rahmen der KGB-Aktionstage statt.
Lesung von Sabrina Lorenz: »Weil Sonnenblumen auch im Winter blühen«
Samstag, 25.10.2025
15 Uhr
Eintritt frei
Anmeldung
bis 24. Oktober unter info@baerenzwinger.berlin
Sprache: Deutsche Lautsprache
Bitte beachten: Die Lesung findet im unbeheizten Lichthof des Bärenzwingers statt. Wir empfehlen, warme Kleidung mitzubringen.
»Gefühle sind dazu da, gefühlt zu werden.«
Was pathetisch klingt, ist in Wahrheit ein Aufruf zu Ehrlichkeit, Zartheit und Selbstreflexion.
Mit ihrem Buch »Weil Sonnenblumen auch im Winter blühen« nimmt Sabrina Lorenz ihre Leser*innen mit auf eine poetische Reise durch die vier Jahreszeiten – und zugleich zu sich selbst.
Als Aktivistin und Slam-Poetin versucht die Autorin, Sabrina Lorenz, die Komplexität eines Lebens mit einer chronischen, fortschreitenden und lebensverkürzenden Erkrankung abzubilden.
Dies beinhaltet all die Emotionen und Gedanken, die mit den ganz persönlichen Herausforderungen und Konfrontationen, aber auch im Kontext eines patriarchalen und ableistischen Systems auftauchen können.
Es geht um Gerechtigkeit und das Ermutigen, die eigene Stimme zu erheben in einem Meer von Vorurteilen – in dem marginalisierte Gruppen keinen Platz zu haben scheinen.
Es geht um Verwundungen, Diskriminierung, Wachstum und Neuanfänge.
Es ist ein Buch voller Hoffnung, Verständnis, radikaler Ehrlichkeit und Mut – mit einfühlsamen Texten, die ins Herz gehen, im Kopf bleiben und den Lesenden das Gefühl geben, gesehen und gehört zu werden.
Über die Autorin:
Mit ihrem Blog @fragments_of_living klärt Sabrina Lorenz auf und setzt Impulse für Disability-Empowerment.
Sie bringt Inklusion auf die Bühne und in die Mitte der Gesellschaft. Sei es als Keynote-Speakerin, als Mitveranstalterin gemeinsam mit dem Initiator Kevin Hoffmann des größte deutschlandweite Community-Event für Menschen mit Behinderungen und / oder chronischen Erkrankungen: dem Kämpferherzen-Treffen oder gemeinsam mit dem Para-Olympioniken Moritz Brückner in ihrem gemeinsamen Podcast »Inklusiv UNS«.
Ihr Buch »Weil Sonnenblumen auch im Winter blühen« (2023) schafft Raum für Austausch, Verständnis und Mut – ein Muss für Betroffene und Angehörige. Ausgezeichnet als Teil der Zeit Campus »30 unter 30« (2024) und als erste behinderte Person bundesweit, die sich für inklusiven Klimaschutz im Zuge der »Zukunftsklage« (September 2024) vor dem Bundesverfassungsgericht stark macht, setzt Sabrina Lorenz ein Zeichen für eine diverse und demokratische Zukunft.
Katrin Bittl
Katrin Bittl (*1994 in München) ist bildende Künstlerin, freie Autorin und Peer Beraterin für Künstler*innen, in München. Bis 2023 studierte sie Freie Kunst an der Akademie der Bildenden Künste München. Eine zentrale Auseinandersetzung ihrer künstlerischen Arbeit stellt die Dekonstruktion von Körper- und Handlungsnormen da. Insbesondere die Körperwahrnehmung von Frauen mit Behinderungen untersucht sie mittels Selbstportraits und Videoperformances.
Den Fokus legt sie dabei auf eine möglichst direkte Sichtbarmachung, aber dennoch unaufdringliche Konfrontation mit diversen Körpern. Mit der Verortung ihres eigenen Körpers in der Pflanzenwelt wirft sie Fragen über „Care Arbeit“, den Fürsorgebegriff und gesellschaftliche Leistungsideale auf.
Ihre Arbeiten wurden in nationalen und internationalen Solo- und Gruppenausstellungen gezeigt, u. a. in der Galerie Bezirk Oberbayern, München (2023); DG Kunstraum, München (2024); HAU Hebbel am Ufer, Berlin (2022); Vivo, Vancouver (2023) und Platform, München (2022). Ihre künstlerische Praxis wurde u. a. durch das Stipendium für Bildende Kunst der Landeshauptstadt München (2024), den Preis des Akademievereins (2023) sowie eine #takeHeart-Residenz im Rahmen von NEUSTART KULTUR (Hebbel am Ufer, Berlin, 2022) gefördert.
Seo Hye Lee
Seo Hye Lee ist eine gehörlose südkoreanische Künstlerin mit Wohnsitz in Großbritannien. 2017 schloss sie ihren Master in Visual Communication am Royal College of Art in London ab. Ausgehend von ihrer Erfahrung mit Hörverlust und als Trägerin von Cochlea-Implantaten arbeitet sie mit Zeichnungen, bewegten Bildern und multisensorischen Installationen, um das komplexe Verhältnis von Klang und Stille zu erforschen. Ihre Praxis ist von einem Engagement für Zugänglichkeit und Zusammenarbeit geprägt und schöpft aus kollektiven wie persönlichen Begegnungen mit Klang.
Ihre Arbeiten wurden in nationalen und internationalen Ausstellungen gezeigt, u. a. im V&A Museum, London (2025–26); Kunsthalle Bremen (2025); Tate Exchange, London (2019); MIMA – Middlesbrough Institute of Modern Art (2024–25); Science Gallery London (2023–24); Royal College of Art, London (2017); Blackwood Gallery, Mississauga (2025); Chapter Arts Centre, Cardiff (2023); Tangled Art + Disability, Toronto (2024); CCA Glasgow (2022) und Nottingham Contemporary (2022).
Außerdem nahm sie an Festivals teil, darunter die Selected 12 UK Tour (2022) – u. a. CCA Glasgow, Fabrica Gallery, Nottingham Contemporary, John Hansard Gallery – sowie Presents 2023 in Kanada und Deutschland. Ihre Forschung und Projekte wurden u. a. durch die Vital Capacities Residency (2021) und das DYCP-Programm des Arts Council England (2020) gefördert.
Anika Krbetschek
Anika Krbetschek (*1997 in Berlin) ist eine frühlingsgeborene Künstlerin, Kuratorin und Autorin aus Berlin. In postdisziplinären Recherchen rückt sie das, was an den Rändern von Psyche, Trauma und Erinnerung geschieht, ins Verhältnis zu Systemen, kollektiven Gedächtnissen und Neurophysiologie. Dort, wo sich Politik und Geschichte in Körpern und Stimmen niederschlägt und psychologisches Wissen eine Geschichte hat, entwickelt sie eine Praxis, die zuhört, erfährt und verdichtet.
Ihre Projekte, die Teilhabe und Erfahrungsexpertisen zentrieren, schaffen künstlerische Formate, in denen widerständige Gedächtnisse und innere Wirklichkeiten Teil eines inklusorischen Diskurses werden können. Ihre Arbeiten wurden in nationalen und internationalen Solo- und Gruppenausstellungen gezeigt, darunter Petersburg Art Space Gallery, Berlin (2024); Living Room Studio, Yerevan (2025); Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (2024); Goethe-Institut, Yerevan (2024) und KunstHaus Potsdam (2023).
Außerdem nahm sie an diversen Festivals teil, u. a. Reeperbahn Festival, Hamburg (2023); 48h Neukölln Arts Festival, Berlin (mehrfach seit 2020) sowie Grenzen sind relativ Festival, Hamburg (2023). Ihre künstlerische Arbeit wurde u. a. durch die Kulturstiftung des Bundes (2025), den Kulturfonds Culture Moves Europe (2025) und die Bundeszentrale für politische Bildung (2023) gefördert.
Zorka Lednárová
Zorka Lednárová (*1976 in Bratislava/Slowakei ist eine zwischen Bratislava und Berlin lebende Künstlerin und Kuratorin. Sie studierte Bildhauerei, Freie Kunst und Kalligraphie an der Kunsthochschule Bratislava, der Muthesius Hochschule für Kunst und Gestaltung in Kiel, an der Nationalen Kunstakademie in Hangzhou, China, sowie an der Universität der Künste Berlin. In raumgreifenden Installationen, Fotografien und Arbeiten im öffentlichen Raum erforscht sie Barrieren – physische wie soziale – und ihre Wirkung auf Teilhabe, Sichtbarkeit und Zugehörigkeit.
Ihre Arbeit nutzt biografische Erfahrungen und oft irritierende Eingriffe, um Perspektivwechsel zu ermöglichen, Machtverhältnisse zu hinterfragen und Teilhabe neu zu denken. Ihre Arbeiten wurden in nationalen und internationalen Solo- und Gruppenausstellungen gezeigt, u. a. im Kunsthaus Dresden (2025), OKK/Raum 29, Berlin (2025, 2021), Kunsthalle Bratislava (2024, 2023, 2019), Plato – Ostrava City Gallery (2023) und Gesellschaft für Aktuelle Kunst, Bremen (2025). Außerdem nahm sie an Festivals teil, u. a.), Biela Noc Bratislava (2023) und Ostrava Camera Eye (2023).
Sie erhielt zahlreiche Förderungen, u. a. von der Stadt Bratislava (2023), dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (2023), der Senatsverwaltung für Kultur und Europa Berlin (2020) und Pro Helvetia (2020). Als Mitgründerin und langjährige Leiterin des Projektraums OKK/Raum 29 entwickelte sie Plattformen für internationalen Austausch und kollaborative Formate.