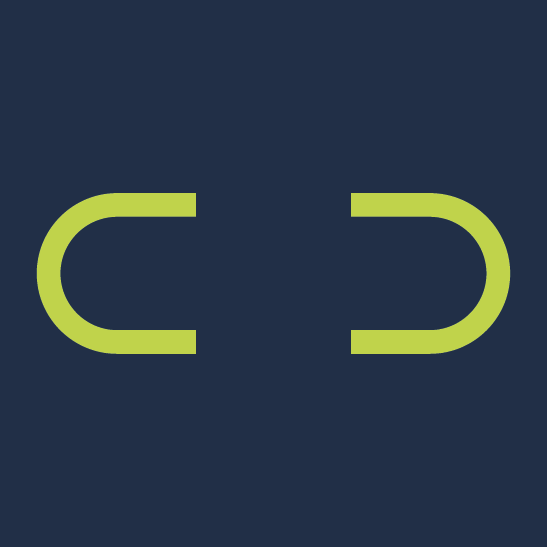1937
Bis zu jenem Tag im Herbst 2015, an dem Schnute, die letzte weibliche Stadtbärin eingeschläfert wurde, beherbergte der Bärenzwinger für fast achtzig Jahre mehrere Generationen von Braunbären, den Berliner Wappentieren.
Der Bärenzwinger wurde am 17. August 1939 mit den vier Bären Urs, Vreni, Lotte und Jule offiziell eröffnet. Urs und Vreni kamen aus dem weltbekannten Berner Bärengraben und waren Geschenke der Stadt Bern anlässlich der 700-Jahrfeier Berlins im Jahr 1937.
Das ursprünglich als Stadtreinigung erbaute Gebäude im Köllnischen Park, war vom Berliner Architekten Georg Lorenz zum Bärenzwinger um- und ausgebaut worden.
Eingebunden in eine fast achtzigjährige bewegte Stadtgeschichte stand der Bärenzwinger zweimal vor dem Aus. So kamen alle Bären bis auf Lotte während des Krieges um und der Bärenzwinger selbst wurde verschüttet. Das Areal wurde dank des Einsatzes von Bürger*innen vom Schutt befreit und am 29. November 1949 mit den Bärinnen Nante und Jette wiedereröffnet.
Der Erhalt des im Ostteil der Stadt gelegenen Bärenzwingers stand kurz nach dem Mauerfall angesichts seines schlechten baulichen Zustandes erneut zur Debatte, bis private Spendeninitiativen seine Restaurierung in Gang brachten.
Seit etwa den Nullerjahren regte sich wiederum aufgrund von Zweifeln am Wohlergehen der Tiere zunehmend Widerstand gegen die Haltung von Bären in dem Areal. Die tierschutzrechtliche Kritik veranlasste schließlich den kommunalen Beschluss, dass nach dem Tod von Schnute keine weiteren Bären in den Zwinger einziehen würden.
2017
Durch die Übertragung des Fachvermögens an das Amt für Weiterbildung und Kultur und die Bereitstellung von Fördermitteln durch spartenübergreifende Förderung ist es möglich, im Baudenkmal Bärenzwinger Ausstellungen und Veranstaltungen, Vorträge und Diskussionen durchzuführen. Künstler*innen und Wissenschaftler*innen werden vor Ort ihre Ausstellungsideen entwickeln und in schrittweisen und behutsamen ortsspezifischen Interventionen und Rauminstallationen präsentieren.
Organisiert wird das Kulturprogramm des Bärenzwingers von jungen Kurator*innen des Fachbereichs Kunst und Kultur Mitte, die für den Zeitraum ihres wissenschaftlichen Volontariats den Bärenzwinger als Ort der Praxis und des Lernens zur Verfügung gestellt bekommen.
Damit hat das Amt für Weiterbildung und Kultur nach fast 2-jährigem Leerstand die Verantwortung für ein Kulturdenkmal übernommen, das sich durch die Berliner Wappentiere über 80 Jahre zu einem stadträumlichen Anziehungspunkt mit hohem Bekanntheits- und Sympathiewert entwickelt hat.
Die immense identitätsstiftende Wirkung des Bärenzwingers bei Berliner Bürger*innen ist deshalb auch von beispielhaftem Wert, sowohl für die künftige Stadtgestaltung im Bereich der nördlichen Luisenstadt als auch jener nahegelegenen historischen Berliner Mitte, derer sich das Bezirksamt nun angenommen hat.
Ziel ist es, den Standort als öffentlichen, kulturellen Lern- und Lehrort sowie Wissensplattform für Stadtkultur zu entwickeln. Zusätzlich sollen durch Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen Bezüge zur kulturellen Stadtgestaltung, Berlingeschichte und Gegenwartskunst hergestellt und vermittelt werden.
Das kuratorische Programm des Bärenzwingers für den Zeitraum von September 2017 bis Januar 2019 wurde aus einer Auseinandersetzung mit der Geschichte des Areals und der dort lebenden Tiere, der Nutzerinnen und auch Kritikerinnen heraus entwickelt. Es öffnet sich vielfältigen Formen und Formaten und lotet das Potenzial des Ortes für historische, umweltpolitische, kulturelle und künstlerische Interventionen aus.
So geht es etwa auf die Rolle von Bärenzwinger und Bären im Rahmen der kulturellen und gesellschaftlichen Identitätsstiftung der Stadt ein, auf die Architektur des Geländes und dessen urbanistische Einbindung und auf ökologische und tierschutzrechtliche Diskurse, die an den Bärenzwinger gekoppelt sind.
Der zuvor fast zwei Jahren leerstehende Bärenzwinger birgt noch immer zahlreiche Spuren seiner Nutzungsvergangenheit als langjähriges Domizil der Berliner Symbolträger.
Das Ausstellungsprogramm im Bärenzwinger gliedert sich in drei thematische Schwerpunkte.
Der erste mit dem Titel »Spuren des Animalischen« befasst sich mit der spürbaren Absenz / Präsenz der Bären. Der zweite Schwerpunkt fokussiert »Architekturen der Segregation«, die sowohl die Innen- als auch die Außenräume des Bärenzwingers durchziehen. Unter dem Titel »Projektionen der Ununterscheidbarkeit« entwickelt der dritte kuratorische Programmpunkt schließlich Ideen für Perspektiven und zukünftige Szenarien des Bärenzwingers.
2019-
2020

Mit »Fictional Odyssey« begibt sich der Bärenzwinger auf eine Reise, die die Herausforderungen und Möglichkeiten unserer Gegenwart und Zukunft erkundet.
Das Ausstellungs- und Vermittlungsprogramm untersucht die Fiktion als eine Kulturtechnik, die die Simulation und Vorstellung alternativer Realitäten ermöglicht.
Als solche ist sie grundlegend für viele der uns bekannten Metamorphosen. Die Fiktion als solche ist nicht willkürlich und bezieht ihre Kraft aus der geschickten Erweiterung des eigentlich Möglichen ins Unmögliche.
Ziel ist es, den Bärenzwinger als Ort der Auseinandersetzung mit Geschichte, Kunst und Kultur für möglichst viele Altersgruppen zu öffnen, um das Interesse an künstlerischen Handlungsweisen und Formensprachen zu wecken.
Der Bärenzwinger ist ein Ort für die Bürgerinnen und Bürger Berlins, für Künstler und Kulturschaffende ebenso wie für Besucher. In seiner behutsamen Transformation vom Bärengehege zum Kulturort für zeitgenössische Kunst spricht das Projekt ein heterogenes und generationenübergreifendes Publikum an.
Der Bärenzwinger ist ein Ausstellungsraum, der seit 2017 die Spuren seiner Vergangenheit als Bärengehege aus den unterschiedlichsten zeitgenössischen Perspektiven beleuchtet.
Das stille, nicht greifbare Erbe des Gebäudes liegt jedoch noch immer schwer in der Luft.
Mit der Verwandlung des Bärenzwingers in einen Kulturort haben wir uns die Frage gestellt, wie wir uns der Öffentlichkeit nicht als Tiergehege, sondern als denkmalgeschützter Kulturort öffnen können, der soziokulturelle Fragen der Gegenwart aufgreift.
Unsere Arbeit im Jahr 2020 bestand vor allem darin, den Akteuren zuzuschauen und zuzuhören und unsere eigenen institutionellen Bedingungen für verschiedenste Öffnungsprozesse aktiv zu reflektieren.
Das Programm präsentierte eine Reihe von Erkundungen der weniger sichtbaren Gegenwart und Geschichte der Bärenzwinger.
Bricolage beschreibt einen sowohl praktischen als auch poetischen Prozess, den Claude Lévi-Strauss dem westlichen Ingenieur gegenüberstellt und der sich durch Spiel, Improvisation, Sampling und DIY-Strategien entfaltet.
Wie Jacques Derrida betont, ist diese Gegenüberstellung unhaltbar, und der Ingenieur selbst ist ein Mythos, ein Produkt der Bastelei.
Das Programm schlug eine reparative Lesart des Konzepts »Bricolage« vor. Durch einen Prozess der Öffnung, Zusammenarbeit und Konversation wurde Bricolage auf queere und antikoloniale Weise überarbeitet.
Bricolage soll verschiedene Szenarien durchkreuzen, bisherige Definitionen destabilisieren und neue Narrative jenseits des dominanten Erbes des Bärenzwingers als Heimat der Berliner Wappenbären schaffen.
»Ephemeris« kann als eine Art Tagebuch verstanden werden, in dem die Konstellationen von Planeten, Sternen und Körpern festgehalten werden. »Ephḗmeros« bedeutet im Altgriechischen wörtlich „für einen Tag“ und kann mit den ersten Formen der Organisation von Tagen in Übereinstimmung mit den jahreszeitlichen Veränderungen in Verbindung gebracht werden, die sich zu physischen Aufzeichnungen mit Namen von Zeiträumen entwickelten, die als Kalender verwendet wurden.
Im Jahr 2022 wurde der Raum Bärenzwinger von eingeladenen Künstlern als Garten, Werkstatt, Performance-Bühne, Archiv, Speisekammer und Schutzraum genutzt.
Das Programm war geprägt von ephemeren Kunstformen und Materialien. Performative und aktionsbasierte künstlerische Praktiken besetzten den Bärenzwinger und sprachen durch Klang und Geräusch, Duft und Berührung die Sinne an.
»Gleaning« ist, einfach ausgedrückt, der Akt des Sammelns von dem, was nach der Ernte auf dem Land liegen geblieben ist. Aufgesammelt wird das, was durch die etablierten Strukturen hindurchgefallen ist. Es ist eine Praxis, die hoffnungsvoll ist, eine rücksichtsvolle Haltung einnimmt und in der west- und mitteleuropäischen Tradition in Gruppen durchgeführt wurde.
In der heutigen Zeit hat sich die Bedeutung und Haltung dieser Praxis fortgesetzt, aber verändert und erweitert, wie in Agnès Vardas Dokumentarfilm »The Gleaners and I« zu sehen ist.
Man hebt eine Kartoffel, einen Gegenstand, einen Gedanken auf und überlegt: Wie kann dies verwendet werden? In Zeiten von (im-)materieller Knappheit, wirtschaftlicher Inflation, politischer Unsicherheit und einer tiefen Klimakrise eröffnet diese Praxis eine Möglichkeit, um mit unserem sozialen und ökologischen Umfeld in Verbindung zu treten.
Manchmal bedeutet es, etwas zurückzulassen, Raum offen zu halten. Denn »Gleaning« ist in erster Linie eine Art der Wahrnehmung. Es bedeutet, der Umgebung mit offenen Sinnen zu begegnen. Auf der Suche nach dem Unbeachteten, dem auf den ersten Blick Unwichtigen. Es balanciert zwischen Betrachten und Bewerten. Mit seiner Anwendung üben wir uns in Achtsamkeit.
Linien durchdringen unseren Alltag auf sichtbare und unsichtbare Weise: Linien konstruieren die Architektur unserer Städte, weisen uns den Weg entlang von Straßen, Flüssen, Fluchten und Pfaden, wachsen aus Punkten zur Schrift und zum Bild, erzeugen als Grundbestandteil des Goldenen Schnitts seit jeher einen Sinn für Schönheit in Natur und Kunst, markieren Orte der Trennung und des Zusammenseins. Ob als Ausdruck individueller Wege, als Metapher für Beziehungen oder als abstraktes Konzept – Linien bieten einen großen Interpretationsspielraum, den der Bärenzwinger mit seinem Jahresprogramm 2024 ausloten möchte.
In vier Ausstellungen unter dem Titel »Kanten und Knoten« erkundet der Bärenzwinger Linien als grundlegendes Element von Netzwerken, in denen Knoten für Menschen oder Orte stehen und Kanten die Beziehungen zwischen ihnen darstellen – angelehnt an die Graphentheorie, nach der Knoten einzelne Punkte und Kanten die Verbindungen zwischen ihnen repräsentieren.
Im Kontext des Bärenzwingers ist die Verhandlung von Linien besonders relevant. Als ehemaliger Zwinger ist er mit seinen Käfigstangen und Wassergräben dafür geschaffen worden, Bären und Besucher*innen, Tiergehege und Stadt zu trennen. Gleichzeitig fungierte er als Ort der Begegnung zwischen Tier und Mensch, Natur und Kultur. Somit steht der Bärenzwinger exemplarisch für die Dualität von Linien als Grenzen und Verbindungen.
Davon ausgehend lädt die Ausstellungsreihe dazu ein, über die vielfältigen Möglichkeiten nachzudenken, mit denen Linien – ob „natürliche“ oder vom Menschen geschaffene – unsere Interaktionen mit der Welt und miteinander prägen.
2025-
2026
Aktuelle kulturpolitische Entwicklungen in Berlin und Deutschland, die Erfolge, die rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien mit ihrer Agenda der Ausgrenzung in westlichen Ländern feiern, sowie die sich zuspitzenden Kriegsszenarien und Bestrebungen zur Militarisierung weltweit stellen die Idee und Praxis eines wohlwollenden Miteinanders und Zusammenstehens gegenwärtig auf eine harte Bewährungsprobe. Von der wachsenden Sensibilität für die Belange und Verletzlichkeit der Bürger*innen, vor allem der Pfleger*innen im Gesundheitswesen, und einer neuen Wertschätzungskultur, wie sie sich noch während der Covid-Pandemie abzeichnete, scheint nach nur kurzer Zeit wenig geblieben. Vielmehr drängt sich in verschiedenen sozialen Kontexten die Frage auf, wer dazugehört, und viel wichtiger noch, wer nicht. Wie verhält es sich mit der Nächstenliebe in Anbetracht gegenwärtiger gesellschaftlicher Entwicklungen? Sorgen wir uns umeinander und wenn ja, auf welche Weise und wer spürt diese Zuwendung? Entscheidender noch, wer nicht? Das kommende Jahresprogramm möchte sich unter der Überschrift „Handle (with) Care“ eingehend mit gegenwärtigen Politiken des Sozialen beschäftigen und diese im Rekurs auf historisch-politische, soziologische und moralphilosophische Diskurse und Tendenzen ausleuchten.
Im Zeichen feministischer Care-Ethik ist das Thema rund um Sorge oder Fürsorge als elementare, dafür aber ungesehene und kaum anerkannte Ressource unter dem Begriff „Care Work / Care Labour“ vielfach kritisch diskutiert worden. Jede kapitalistische Ökonomie profitiert von der gesellschaftlich längst nicht honorierten emotionalen und häuslichen Care-Arbeit von Frauen und FLINTA* weltweit. Liebe, Aufmerksamkeit und Zuwendung als wesentliche Eigenschaften der affektiven Arbeit von Frauen* Zuhause, auf der Arbeit oder in sozialen Vereinen, werden gesellschaftlich nach wie vor nicht wertgeschätzt und als Emotionen und Affekte kommodifiziert. Das ambivalente Ungleichgewicht darin, wer Sorge spendet und wer sie erfährt, schlägt sich in heterosexistischen Affektökonomien und Lebensweisen wieder, wofür die statistische Diskriminierung in der Gender-Pay-Gap zweifelsohne einschlägig ist: die Frau bleibt dabei an ihre Fürsorgerolle gebunden, weil ihr Partner besser verdient und damit der materielle Wohlstand („material care“) der Familie gesichert ist (vgl. Kirsten R. Ghodsee). Die emotionale Arbeit („emotional care“) bleibt so gegenüber der ökonomischen Abhängigkeit zweitrangig. Wie wir uns beispielsweise verlieben, entscheidet womöglich nicht das Herz, sondern das Geld. Die um sich selbst kreisende Gen Z artikuliert stattdessen auf Social Media selbstbewusst ihr Bedürfnis nach „health“, „self care“ oder der „emotional care“, die sie sich in Freund*innen- und Partner*innenschaften wünschen.
Dass nicht alle Menschen einer Gesellschaft den gleichen Zugang zu Unterstützung jeglicher Form, Versorgungsketten und Aufstiegsmöglichkeiten haben, lässt sich nicht leugnen. Trotz eines wachsenden Bewusstseins für die Belange und Anliegen benachteiligter oder ungesehener Personengruppen, im spezifischen „Communities“, im Zeichen eines identitätspolitischen Wandels im Kulturbetrieb, stehen viele Personen nach wie vor am gesellschaftlichen Rand. „Communities“ verwenden wir in der Mehrzahl, da der Ausdruck so als Selbstbezeichnung für marginalisierte Interessengemeinschaften mit Diskriminierungserfahrung international üblich geworden ist und sich darin gesellschaftliche Diversifizierung und Heterogenität widerspiegelt.
Durch gelebte Solidarität für die eigenen Ausgrenzungserfahrungen und geteilten politischen Werte entwickelt sich in einer Community ein Wir-Gefühl als identitärer Kern, in dem sich unterschiedliche Personen angesprochen und dargestellt fühlen (vgl. Diversity Arts Culture). Wer ist Teil einer Community und wie wird man also solcher gelesen oder sichtbar?
Was ist also dran am „caren“ füreinander? In ihrem Essay „A manifesto for radical care of how to be a human in the arts“” spricht die Kuratorin und Künstlerin Tian Zhang von der Ungerichtetheit von Fürsorge, Herzlichkeit und Pflege: „care doesn’t flow in one direction or even reciprocally but rather gathers where it is needed” (vgl. den Weblink zu Zhang) und diagnostiziert: „Care is not just a feeling; it is action, process, practice, impact.“
Dass es sich mit dem Gebot der Nächstenliebe zwiespältig verhält, hat Slavoj Žižek einmal mit seiner Aussage „Love thy neighbour? No thanks!“ pointiert formuliert. In seinen Ausführungen in The Plague of Fantasies (1997) unterzieht er das christliche Gebot der Nächstenliebe als eine Form von „care“ einer kritischen Betrachtung, in der diese als idealisierte Lebensführung der realen menschlichen Lebenspraxis gegenübergestellt wird und so als eine selbsttäuschende und vor allem widersprüchliche Einstellung entlarvt wird. An der Figur des Nachbarn sollen die Schwachstellen und Grenzen dieses Gebots deutlich werden: Kommt uns eine Person, die wir aus der Ferne wohl kennen, erst einmal zu nahe, wird die einst vertraute und angenehme Vorstellung von ihr zu einem bedrohlichen Fremden, mit dem man sich konkret auseinanderzusetzen hat. Was hat es also mit der bedingungslosen Liebe oder, bescheidener gesagt, der alltäglichen Freundlichkeit auf sich? Es ist nahezu unmöglich, für jeden Menschen gleichermaßen Sympathie zu empfinden. Liebe könne nicht als bedingungslos gelten, so Žižek. Ebenso wenig wie Sympathie jeden Menschen erreicht, tut es auch das Sorgen füreinander nicht.
Als einstiger Vorgängerbau eines Stadtreinigungsdepots inklusive öffentlicher Bedürfnisanstalt um 1900 – vor seiner Inbetriebnahme und ideologischen Umfunktionierung durch die Nationalsozialisten als symbolträchtiger Bärenkäfig ab 1938 – ist das Thema auf ambivalente wie vielschichtige Weise in die Bausubstanz des Bärenzwingers eingeschrieben. Gebaut mit den übriggebliebenen Ziegeln des früheren Stadtreinigungsdepots, erfüllte der Bärenzwinger in seiner Architektur- und Nutzungsgeschichte zweifelsohne seine Rolle als “Pflegeinfrastruktur”, einer Einrichtung also, die durch ihre Ressourcen und Maßnahmen zur Instandhaltung einer Stadt oder Region beiträgt.
Als öffentlicher Kulturort für zeitgenössische Kunst sucht der Bärenzwinger heute den bewussten Austausch mit der Nachbarschaft und anliegenden Kulturakteur*innen und Schulen. Als Einrichtung des Fachbereichs Kunst, Kultur und Geschichte im Bezirksamt Mitte ist der Bärenzwinger zudem eine kommunale Galerie in Berlin und damit in ein weiteres strukturelles Netzwerk mit einer übergreifenden Erinnerungsgeschichte eingebunden, das die “community care” gewissermaßen schon im Namen trägt. “Community care” versucht die Agency (Handlungsfähigkeit) vor allem marginalisierter Personengruppen zu stärken, Ungleichheiten in der Verteilung von Macht entgegenzuwirken und Zugang zu exklusiven Räumen und Strukturen durch Unterstützung und Fürsorge zu gewährleisten. Die ersten kommunalen Galerien entstanden in den Nachkriegsjahren 1945–1949 im Zuge der Schaffung der ersten Kunstämter und waren primär für die “Betreuung und Erfassung der Künstler zuständig”, um Lebensmittelkarten an Künstler zu vergeben, die so über die Kulturämter versorgt wurden (Gillen, S. 13).
Im Vordergrund dieser Kulturpolitik der Nachkriegsjahre stand die substantielle Unterstützung der bildenden Künstler*innen und Grundversorgung der Bezirke mit Kultur. Die Schaffung von Ausstellungsflächen stand bei diesen Bemühungen an zweiter Stelle (vgl. auch Bauer).
Vor diesem Hintergrund stellt sich für den Bärenzwinger die Frage, inwieweit sein Erbe als Pflegeinfrastruktur und kommunale Einrichtung sich im gegenwärtigen Galeriebetrieb wiederfindet und in welcher Weise dieses Erbe zukünftig in der kuratorischen Praxis und Vermittlungsarbeit umgestaltet und weiterentwickelt werden kann. Wie kann hier Gemeinschaft entstehen und fortbestehen? Vor welchen Chancen und Problemen steht der Bärenzwinger als Ausstellungsraum im Zentrum der Stadt und welche Rolle spielt er als öffentlicher Raum für das Zusammenleben in Berlin-Mitte? Ferner lässt sich fragen: Wer gehört zur Stadt Berlin und wem gehört sie? Wo ermöglicht der Bärenzwinger als Raum Teilhabe und wie lässt sich dieser Ansatz noch weiter fördern? Wie spiegelt sich die Kommunalität hier wieder? Wie könnte der Bärenzwinger vielleicht “flows of care” (Zhang) weiter implementieren in jene Bereiche, die bisher noch nicht berührt wurden?
Das Jahresprogramm 2025 des Bärenzwingers erörtert unter der Überschrift “Handle (with) Care” in vier Ausstellungen die Frage, wie Gemeinschaft vor dem Hintergrund aktueller sozialer und kulturpolitischer Entwicklungen gelebt wird, was uns zusammenhält und was uns entzweit. Dabei sollen jene Grauzonen und Grenzen beleuchtet werden, die bestimmte Personengruppen auf Abstand halten und von Fürsorge abschneiden bzw. es verunmöglichen, sie in diese einzubeziehen.
Der Titel “Handle (with) care” drückt das Doppelsinnige der Care-Thematik aus: den menschlichen Wunsch nach Annäherung und Zuwendung bei gleichzeitiger Abwendung und Ignoranz durch Klassismus, Diskriminierung und Menschfeindlichkeit. Die Prämisse, etwas oder jemand sei mit Anteilnahme oder Vorsicht, d.h. mit Feingefühl, Empathie und Fürsorge zu behandeln, soll ebenso kritisch befragt, wie als Aufforderung zu einem gemeinsamen Miteinander verstanden werden. Das gilt aber weniger im Sinne einer moralischen, normativen Forderung, also des Imperativs: „Sorgt euch umeinander!” Vielmehr ist es unsere Überzeugung, dass es sich bei Anteilnahme und Fürsorge um Grundpfeiler menschlichen Zusammenlebens überhaupt handelt. Wir sehen darin aber durchaus einen Anspruch unseres Ausstellungsraums und verstehen das Motto als performativen Anstoß. Die typografische Aus-, Um- und Einklammerung des “with” verweist ferner auf die feinen Unterschiede, die mitunter definieren wer oder was je zu unserer Gemeinschaft/Gesellschaft gehört, und greift mit seiner Form den Grundriss des Bärenzwingers auf.
Das Projekt möchte sich übergreifend die Frage stellen, wer am meisten Hilfe oder Fürsorge in unserer Gemeinschaft benötigt und ob diese überhaupt für jene Menschen verfügbar ist? Wer entscheidet darüber und wie ungleich ist “Care” in unserer Gesellschaft verteilt? Welche Leben sehen wir und welche nicht? Welche von ihnen erhalten jenen Schutz, der ihnen eigentlich zukommen sollte und welche soziokulturellen und -politischen Werte schließen Anteilnahme und Schutz systemisch aus? Und nicht zuletzt: Wer nimmt Platz an unserem Tisch?